Erinnerungen, die Vergangenes in die Gegenwart überführen
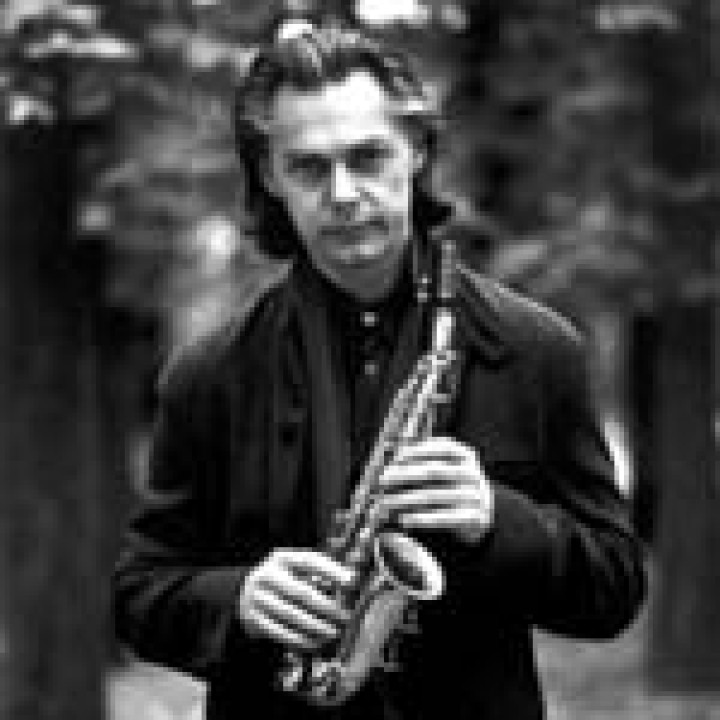
26.07.2001
Das neue gemeinschaftliche Album von Jan Garbarek und dem Hilliard Ensemble lebt von der phantasiereichen Spontaneität aller Beteiligten.
Das Wort, das über der neuen Aufnahme von Jan Garbarek und dem Hilliard Ensemble steht, führt auf den ersten Blick tief in die Vergangenheit zurück. “Mnemosyne” heißt im Altgriechischen “Erinnerung”. “Mnemosyne” überschrieb Friedrich Hölderlin auch ein Gedicht, dessen erste Strophe im Textheft zur CD abgedruckt ist. Neben Hölderlins Worten, die Vergänglichkeit und Ewigkeit gleichermaßen beschwören, leiten auch Bilder aus dem Film “Das siebente Siegel” von Ingmar Bergman die Gedanken in die dunkle Nähe einer apokalyptischen Endzeit. Doch wenn der erste Akkord der Sänger sich aus dem Nichts aufbaut, die ersten Töne des Saxophons ihn umspielen, der Klang sich entfaltet, die instrumentalen Akklamationen dichter werden, dann öffnet sich ein weites Feld, eine ganze Welt von Assoziationen.
Zu hören ist: Mnemosyne meint die Erinnerung, die Vergangenes in die Gegenwart überführt. Es ist, als erkundeten die Musiker mit “Mnemosyne” ein unausschöpfbares, kollektives kulturelles Gedächtnis, um etwas Neues, in die Zukunft Gerichtetes entstehen zu lassen. Schon “Officium”, die Verbindung jahrhundertealter geistlicher Gesänge mit den Saxophonimprovisationen Jan Garbareks, war mehr als eine Addition der Kräfte, öffnete Ohren, schärfte Sinne. “Mnemosyne” nimmt dieses gegenseitige Umkreisen, Durchdringen, Inspirieren, Distanzieren, Retardieren zwischen Instrumenten- und Menschenton wieder auf. Anders als die so erfolgreiche erste Zusammenarbeit vor gut vier Jahren zieht “Mnemosyne” einen weitgespannten Bogen durch Zeiten und Kontinente: vom antiken Griechenland über das europäische Mittelalter, Hildegard von Bingen, Dufay, Tallis und das orthodoxe Rußland bis hin zu indianischen Gesängen, einem Wiegenlied des estnischen Komponisten Veljo Tormis und Kompositionen von Jan Garbarek. Ausgewählte, gefundene, erfundene, auch fremde Musik, teils nur in Fragmenten oder Andeutungen erhalten, die von Garbarek und den Solostimmen des Hilliard Ensembles improvisierend neu belebt werden: “Wir skizzierten eine lose Form und verteilten das Material, dann improvisierten wir alle, und niemand wußte, was als nächstes passieren würde”, schreibt John Potter dazu im Beiheft der CD. Eine schweifende Polyphonie, die sich Melodien erlaubt, scharfe Dissonanzen nicht meidet, kommentiert, kontrastiert, kontrapunktiert vom dunklen Grund des Tenor-, den hellen Rufen des Sopransaxophons. Ein Spiel auch mit tradierten Formelementen, wie der Imitation von Motiven oder, nach dem gregorianischen Ruf- und Antwort-Prinzip, mit “Strophe and Counter-Strophe”.
Daß Jan Garbarek und das Hilliard Ensemble, aus scheinbar so verschiedenen Klangwelten kommend, sich zu “Officium” zusammenfanden, war von einer inneren Konsequenz bestimmt. Beide tauchen ein in Traditionen, denen sie mit der Ernsthaftigkeit Ihres Musizierens höchsten Respekt bezeugen und die sie in ihr musikalisches Konzept integrieren. Nach dem Erscheinen von “Officium” vertieften sich die Hilliard-Sänger mit Victoria und Palestrina weiter in die große Zeit der Polyphonie, widmeten andererseits ihr “Songbook” ausschließlich zeitgenössischen Komponisten. Jan Garbarek summierte in seinem jüngsten Doppelalbum “Rites” Erfahrungen aus vielen Kulturen, von seiner heimatlich-norwegischen bis hin zur indianischen – Rituale des Lebens und des Todes. Sowohl das bei “Officium”-Konzerten erprobte vielfältige Zusammenspiel als auch die eigenen Wege, die Jan Garbarek und das Hilliard Ensemble seither gegangen sind, münden in diese gemeinsame Arbeit, von der Garbarek sagt: “Ich glaube, es ist uns in unseren besten Momenten gelungen, etwas Neues zu schaffen, etwas, das bislang nicht zu hören war; es ist etwas entstanden, das es vorher nicht gab.”
“Mnemosyne” ist aber auch von der gestaltenden Hand des Produzenten wesentlich geprägt. Die notierte oder die aus Andeutungen und Eingebungen entwickelte Musik lebt von der phantasiereichen Spontaneität aller Beteiligten während der Aufnahmen am vertrauten Ort, dem österreichischen Kloster St. Gerold. Einmal festgehalten, hat Manfred Eicher die zweimal zehn Titel in kongenialer Dramaturgie so zusammengefügt, als folgten sie einem verborgenen roten Faden, einer imaginären Struktur aus Strophen und Gegenstrophen.
Herbert Glossner
Mehr von Jan Garbarek